23.05.2022


«Die Inspektoren müssen fit bleiben»
Prof. Dr. Rudolf Schmitt ist überzeugt, dass der Schlüssel für mehr Lebensmittelsicherheit die Aus- und Weiterbildung der amtlichen Kontrolleure ist. alimenta sprach mit dem Träger des Werder-Preises.

Prof. Schmitt: «Ein durchschnittlicher Konsument hat das Wort Campylobacter noch gar nie gehört.»
alimenta: Lebensmittel seien noch nie so sicher gewesen wie heute, hört man oft. Stimmt das? Gleichzeitig gibt es täglich Warnungen über Risiken in Lebensmitteln. Prof. Rudolf Schmitt: Ich kann darauf keine genaue Antwort geben, wie wahrscheinlich niemand. Die vielen Lebensmittelwarnungen über Toxine, Rückstände und Mikroorganismen in Lebensmitteln haben nicht nur damit zu tun, dass viel mehr von diesen Stoffen in den Produkten wären, sondern dass das Meldewesen verbessert wurde und die Sensibilität viel grösser ist. Wo man sucht, findet man. Die Resultate werden international verbreitet und man erhält mehr Informationen. Das ist grundsätzlich gut, denn als Produzent oder als Überwacher kann ich entscheiden, was für mich relevant ist und was nicht, wo ich reagieren muss. In dieser Hinsicht hat sich sicher viel verbessert. Früher, zu meiner Studienzeit und in den Siebzigerjahren, waren die Pestizide ein Riesenthema. Die Konzentrationen und die Vielzahl der Pestizide in den pflanzlichen Produkten waren damals viel höher. Es war toxikologisch auch relevant. Heute werden immer noch sehr viele Ressourcen in die Pestizid-Analytik gesteckt. Das ist insofern richtig, als es den Druck auf die Produzenten aufrechterhält. Aber toxikologisch ist es heute meist nicht mehr relevant, und die Lebensmittel sind diesbezüglich sicherer geworden. Aber es entspricht nicht unbedingt dem Augenmerk der Konsumentenschützer und ihrer Medien. Dort wird dieses Thema gerne aufgebauscht. Für Medienwirbel sorgen auch immer wieder Weichmacher in Babyflaschen oder Mineralöl in Recycling-Verpackungen. Die Entdeckungen und Untersuchungen dieser Stoffe sowie über Food Contact Materials sind relativ neu. Inwieweit dort eine toxikologische Relevanz für den Konsumenten besteht, da wage ich kein Urteil. Die entsprechenden Risk Assessments sind zum Teil nicht gemacht und umgesetzt. Die Experten sind sich hier uneinig. Weshalb? Weiss man zu wenig über die Stoffe? Man muss wissen: Welche Stoffe sind in welchen Produkten? In welcher Konzentration? Und wie ist das physiologisch wirksam für Normalverbraucher und für sensible Konsumenten? Da fehlen noch viele Informationen. Ein anderes Beispiel: Mykotoxine werden intensiv analysiert, aber die toxikologische Relevanz liegt hundert- oder tausend Mal über den Konzentrationsbereichen, die analysiert werden. Da muss man sich fragen, ob die Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden. Wir haben für diese Toxine eine ausgezeichnete Analytik in den Labors. Aber das Problem ist die Probenahme und die Probeaufbereitung, beides ist zum Teil ganz schlecht. Das hat zur Folge, dass mit maximaler Präzision Proben untersucht werden, die gar nicht repräsentativ sind. Das Problem besteht in den Sammelstellen? Ja. Das hat mit der häufig sehr inhomogenen Verteilung der Keime, der Toxine und der chemischen Rückstände zu tun. Dort müssten wir mehr machen. Der Lebensmittelinspektor hat es in der Hand, ob die relevante, aussagekräftige Probe ins Labor kommt. Das heisst, die Probeentnahmetechnik muss verbessert werden, aber auch die Inspektionskompetenz der Inspektoren. Dann ist es vor allem eine Frage der Ausbildung der Inspektoren? Und der Weiterbildung. Die Inspektoren brauchen eine permanente Weiterbildung. Wo herrscht sonst noch Handlungsbedarf? Die meisten realen Probleme in den Bereichen Lebensmittelproduktion und -distribution liegen in der Mikrobiologie und Hygiene. Da muss man am Ball bleiben. Die Zahl der gemeldeten durch Lebensmittel übertragenen Erkrankungen, rund 10 000 Fälle pro Jahr, ist seit 30 Jahren gleich geblieben. Das ist alarmierend, und ich muss daraus schliessen: die verantwortlichen Personen, auch die Lebensmittelmikrobiologen, haben ihren Job nicht gemacht. Dazu kommt: Was nicht meldepflichtig ist, Toxinbildner wie Staphylokokken und andere Erreger, wird auch nicht registriert. Ebenfalls unterrepräsentiert sind virale Erkrankungen. Das heisst, die Zahl der Fälle ist noch viel grösser. Eine Verringerung der Zahlen erreicht man nicht mit vermehrter Arbeit im Labor, sondern mit Audits, Inspektionen und mit einer professionelleren Produktion. Welche Gefahren sind grösser geworden? Ganz offensichtlich stärker geworden ist der Campylobacter. Campylobacter hat bereits Ende der Achtzigerjahre die Salmonellen als Nummer Eins abgelöst. Um die Campylobacter-Zahlen zu verringern, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV eine Kampagne gestartet, damit Konsumenten vorsichtiger mit rohem Geflügelfleisch umgehen. Beim wichtigsten Erreger ist es also nicht die Industrie, die handeln muss, sondern die Konsumenten? Ja. Die Frage lautet häufig: Warum hat man die Salmonellen im Griff, und Campylobacter – ebenfalls fäkalen Ursprungs - nicht? Der wichtigste Grund ist, dass Campylobacter eine viel tiefere Infektionsdosis hat. Für eine Krankheit genügt eine simple Kontamination, ohne Vermehrungsphase wie bei den Salmonellen. Deshalb kommen die meisten Campylobacteriose-Fälle aus den privaten und professionellen Küchen. Auch beim Früchte- und Gemüsehandel gibt es Kontaminationsquellen. Hygiene in den Küchen ist enorm wichtig, auch wenn man vielleicht denkt, es sei übertrieben. Manche sagen, man sei früher viel robuster gewesen, die Hygiene werde heute übertrieben. Das ist Quatsch! Aber ich bin auch nicht glücklich mit der Konsumentenaufklärung des BLV. Wieso? Ein durchschnittlicher Konsument hat das Wort Campylobacter noch gar nie gehört. Aber alle kennen die Salmonellen. Das bedeutet für mich ein Versagen, denn der Campylobacter hat die Salmonellen seit 20 Jahren überholt. Auch die Konsumentenschützer und ihre Medien machen da zu wenig. Für die Medien ist es nur interessant, wenn ein grosser Fall mit vielen Betroffenen passiert. Weil das Problem häufig Küchen sind, sind meist nur kleine Gruppen betroffen. Medienmässig gibt das nicht viel her. Gibt es noch andere wichtige Probleme? Ich gehe viele Sicherheitsfragen vom technologischen Standpunkt an und schaue nicht nach einzelnen Organismen. So kann ich mit bestimmten Grundprozessen in der Hygiene ganze Gruppen von Organismen beherrschen, wie durch Erhitzen, Kühlen, Trocknen, Säuern, und so weiter. Viren und Toxinbildner werden ebenfalls erfasst. Damit komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, den Inspektoren und Auditoren. Diese müssen einen Lebensmittelbetrieb danach beurteilen können, ob er seine mikrobiologischen Gefahren im Griff hat. Die Industrie und auch das Handwerk entwickeln sich weiter, und der Inspektor muss fit sein. Nicht nur, was die Organismen betrifft, sondern auch, was die technologischen Prozesse betrifft. Was heisst das konkret? Bei den Kantonalen Labors haben wir Inspektoren, die ein breites Feld an verschiedenen Betrieben beurteilen müssen. Die Schwierigkeit ist, in allen Bereichen à jour zu bleiben und die entsprechende Fachkompetenz zu haben. Bei der Zertifizierung nach den Food Safety Standards gibt es Fachauditoren nur für bestimmte Bereiche. Bei den kantonalen Inspektoren müsste man den gleichen Weg gehen. Es bräuchte Inspektoren, die spezifisch sattelfest sind in bestimmten Sektoren. Heute kann es sein, dass ein Inspektor gerne Restaurants kontrolliert, weil er sich dort auskennt. In eine industrielle Produktion von Nestlé oder Unilever geht er nicht gerne: Dort gibt es viele Profis, die ihm möglicherweise fachlich überlegen sind. Das darf nicht sein! Es führt dazu, dass solche Betriebe weniger häufig oder weniger intensiv geprüft werden als Restaurants. Und das, obwohl eine solche Industrie Millionen von Konsumenten beliefert. Was muss also geschehen? Der MAS-Kurs Food Safety Management, bei dem ich engagiert bin, ist ein Versuch, die Aus- und Weiterbildung der Inspektoren zu verbessern. Nach einer solchen vereinheitlichten Ausbildung muss die lebenslange Weiterbildung erfolgen. Es braucht ein Ausbildungsprogramm für die Lebensmittelinspektoren, vertiefter, als es heute passiert. Was genau müssen die Inspektoren besser wissen oder können? Ein Inspektor muss versteckte Hygienerisiken kennen. Hygienefragen stellen sich schon beim Gebäude: Standort, Transportwege, Material- und Personenflüsse, Zonensystem, und so weiter. Er muss wissen: Welche Materialien lassen sich wie gut reinigen? Wo gibt es Kontaminationsrisiken von der Gebäudestruktur her? Wo bei den Produktionsanlagen? Das ist ein Thema für sich. Denn die Maschinenbauer und Lebensmittelfachleute diskutieren diese Frage meist nicht miteinander. Für die Maschinenbauer spielt Hygienic Design leider eine sehr geringe Rolle. Deshalb habe ich mich auch bei der Europäischen Gruppe für Hygienic Design engagiert. In dieser Gesellschaft bringt man Maschinenbauer und Lebensmittelproduzenten zusammen. Um sicher zu sein, dass hygienische Prozesse funktionieren, muss ich als Lebensmittelhersteller die Prozesse validieren: Wo gibt’s kritische Stellen, die schwierig zu reinigen sind? Wie kann ich sie reinigen und was heisst sauber? Welche Kriterien muss ich anwenden? Dies ist analytisch nachzuweisen. Ein Inspektor muss das kennen, er muss den geschulten Blick für mögliche Probleme haben und die richtigen Fragen stellen: «Was ist Ihr Sauberkeitskriterium? Warum? Wie beweisen Sie, dass sie das erreicht haben?» Da könnte mancher Betrieb Schwierigkeiten haben, zu antworten. Das Ganze ist ja auch eine Kostenfrage… Nicht unbedingt. Es bedeutet nicht automatisch, dass man viel mehr oder länger reinigen muss, sondern dass man gezielt dort reinigt, wo es Sinn macht. Man kann auch Reinigungsmittel, Wasser und Zeit sparen. Ich komme noch mal auf den Inspektor zurück… Im nächsten Leben werde ich Inspektor (lacht). Dieser sollte – gestützt auf seine Beobachtungen – viele Oberflächenproben nehmen und weniger Proben bei den Endprodukten. Die Laboruntersuchungen auf Mikroorganismen, Toxine oder chemische Rückstände zeigen, inwieweit Prozesse und Reinigungsverfahren funktionieren. Eine repräsentative und der Situation gerecht werdende Probenahme ist entscheidend, und es mir wichtig zu betonen, dass Hersteller und amtliche Kontrolle gemeinsam dazu beitragen, das Niveau der Lebensmittelqualität und -sicherheit zu verbessern. Herr Schmitt, wie lange haben Sie an der HES-SO in Sitten gelehrt? Begonnen habe ich am 1. Oktober 1990, in Pension gegangen bin ich am 30. September 2015, also auf den Tag genau nach 25 Jahren. Was hat sich in dieser Zeit am meisten verändert? Wir haben als Ingenieurschule angefangen, da war die Lebensmitteltechnologie eine von vier Abteilungen. Dann hat es sich entwickelt als Bestandteil der Westschweizer Fachhochschule. Früher wurden Ingenieur-Diplome vergeben, dann Fachhochschul-Diplome, dann kam das System mit Bachelor und Master. Weniger Änderungen gab es bei den Studenten, wir hatten immer Berufsleute, also Bäcker, Köche, Metzger, Molkeristen oder Chocolatiers, die während eines Jahres die Berufsmatura machen mussten und dann ihr Studium beginnen konnten. Bis heute kommen rund ein Drittel der Studenten aus den Gymnasien und zwei Drittel aus den Berufen, das ist eine gute Mischung. Wir Dozenten mussten im Verlauf der Jahre immer stärker in Richtung Projekte gehen. Die Beschaffung der Drittmittel wurde immer wichtiger. Das heisst aber auch, dass man einen sehr guten Kontakt zu Wirtschaft und Forschung pflegt. Dozenten and Fachhochschulen haben einen permanenten Stress, denn es gilt, jedes Jahr das Geld zu beschaffen, um Personal, Verbrauchsmaterial und einen Teil des eigenen Lohnes bezahlen zu können. Sie haben auch für die Weltgesundheitsorganisation WHO Einsätze in Afrika gemacht. Worum ging es da? Die Einsätze habe ich von 1995 bis 2007 gemacht, da ging es auch um Food Safety. Ein Projekt hiess «Healthy Market Places», und das Ziel war, auf den Märkten afrikanischer Grossstädte die Hygiene zu verbessern. Die Zustände sind häufig desolat und führen zu Erkrankungen bei den Konsumenten, die dort ihre Lebensmittel einkaufen. Unsere Aufgabe – wir waren zu zweit – war es, die relevanten Personen an einen Tisch zu bekommen und mit ihnen die relevanten Fragen zu diskutieren: Was heisst Food Safety für den Markt, wo sind die Schwachstellen? Wie kann man diese beheben? Wer ist dafür verantwortlich? Ein Beispiel ist ein Markt im nigerianischen Ibadan, wo täglich 20 000 Personen arbeiten und noch mehr Kunden bedienen. Dort gab es auf dem gesamten Areal genau einen Wasserhahn und eine Toilette. Letztere war verstopft und durch Unrat nicht mehr zugänglich. Die Konsequenzen muss ich nicht beschreiben. Die WHO wollte einen Minimalhygienelevel, damit der Marktplatz nicht der Ursprung für Typhus- oder Cholera-Ausbrüche ist. Wir wollten die Verantwortlichen vor Ort dazu bringen, einen Master-Plan zu entwickeln und Vorschläge zu machen, um unter Einbezug aller wirtschaftlichen Interessen die Hygieneprobleme zu lösen. Diese Vorschläge wurden mit uns diskutiert, und wir haben geholfen, für die Realisierung Geld zu mobilisieren. Das hat an manchen Orten, etwa in Tansania, sehr gut funktioniert, in Ibadan aber überhaupt nicht, denn die entscheidenden Personen waren korrupt - eine Frustration von A bis Z. Sie lehren auch in Namibia. Nach Namibia bin ich durch die Organisation B360 education-partnership gekommen, die den Wissensaustausch zwischen europäischen Experten und afrikanischen Studierenden fördert. Deren Gründerin Sabina Balmer wusste von meinen WHO-Einsätzen in Afrika und suchte jemanden, der für den Lebensmittelsektor nach Namibia geht. B360 finde ich eine sehr gute Art von Entwicklungshilfe. Die Namibia University of Science and Technology identifiziert jeweils den Bedarf an externen Fachkräften für zum Beispiel instrumentelle Analytik, Molekularbiologie oder Spezialkurse in Food Safety. Die Anfragen richten sie an B360 und einige gelangen zu mir, und wir versuchen Experten zu finden, welche dieses Wissen vermitteln können und wollen. B360 finanziert den Flug und die Universität stellt ein Apartment auf dem Campus zur Verfügung. Die externen Dozenten geben typischerweise für zwei oder drei Wochen einen Intensivkurs inklusive einer Schlussprüfung. Die besten namibische Studenten dürfen am Ende ihres Studiums in die Schweiz für ein 3-monatiges Praktikum in der Industrie. Das ist sehr wirksam, denn die Abgänger erhalten gute Jobs und können im Land etwas bewirken. roland.wyss@rubmedia.ch
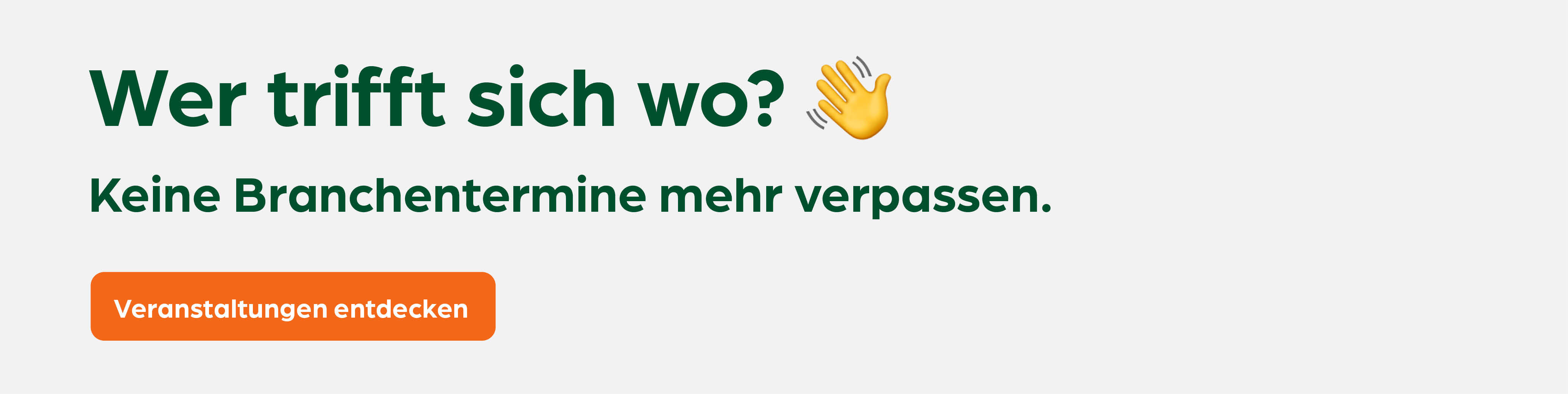

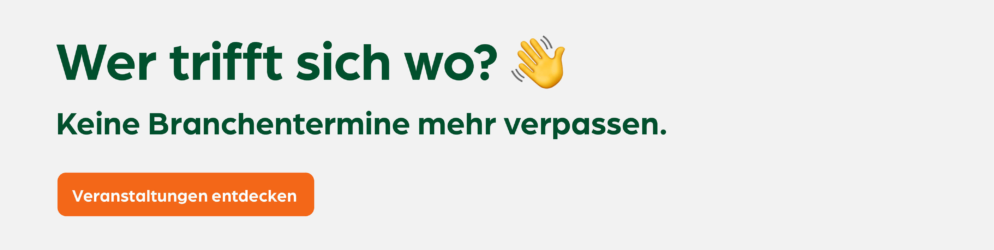
Ähnliche Beiträge
13.11.2023
07.11.2023




