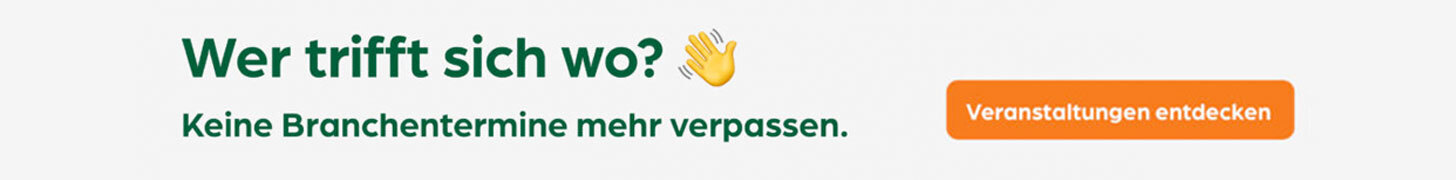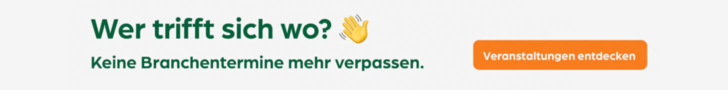21.08.2022


Brennpunkt Nahrung: People, Planet, Profit
Die dritte Ausgabe des Forums Brennpunkt Nahrung in Luzern, fand unter dem Motto: «People», «Planet», «Profit» statt. Rund 320 Teilnehmen waren dabei.
Am Forum Brennpunkt Nahrung in Luzern fing alles mit «P» an. Mit «P» wie Profit startete Hansueli Loosli, der die Erfolgsgeschichte des Gastrozulieferers Transgourmet an der Veranstaltung Brennpunkt Nahrung erläuterte. Loosli hielt gleich zu Anfang fest, dass bei den Firmen im Transgourmet-Konglomerat sich nicht alles integrieren und unterordnen lasse. Schliesslich gebe es Kunden, die nicht gerne beim «Grossen» einkaufen, sondern lieber beim Mittelständler unter eigener Marke. Loosli zeigte einige Perlen im Transgourmet-Netz auf. Zum Beispiel der Grosseeschiffahrtsbelieferer «Jump Steamer», deren internationale Food Supply stetig wachse. Oder die EGV AG, der Vollsortierter der durch die Fusion nicht verloren hat, sondern viele neue Kunden gewonnen habe. Aber auch der Weinhändler Riegger und Casa del Vino und den österreichischen c+c-Händler, Pfeiffer. Auch von der jüngsten Übernahme, des Team Beverage mit 1,5 Milliarden Euro Umsatz, schwärmte Loosli. Sechs Jahre nach der Vollübernahme, sei die Transgourmet aller Ländergesellschaften, Österreich- Central-Europe, Frankreich und der Schweiz, einheitlich unter der Gabel und dem Messer. Wachsender Gastromarkt Der Food-Service-Markt wachse stetig, so Loosli. «Die Gastrobetriebe übernehmen unsere Dienstleistungen». Die Verkehrsknotenpunkte würden immer stärker zu Orten des Konsums. Es gelte, je mehr man unterwegs sei, desto schneller müsse auch die Verpflegung erfolgen. Und auch der demographische Wandel stelle neue Anforderungen an die Verpflegung, wo zum Beispiel die Gesundheit im Zentrum stehe. Transgourmet sei die einzige Firma in Europa, die das Geschäft mit der Abholung und der Belieferung beherrsche so Loosli. Dabei stehe die Belieferung von Kunden an erster Stelle, wobei die Abholung weiterhin möglich sein solle. Die Cash & Carry Standorte in Osteuropa mit den Zentralen in Warschau und Bukarest sollen professionalisiert werden. Die Non-Food-Sortimente sollen reduziert. Dabei soll nicht mit 10 000-, sondern mit 30 000 Artikel gearbeitet werden. Der Transport würden dadurch zwar nicht billiger, so müsste jedoch die Fläche billiger sein, so Loosli.
«Ohne unsere Nachhaltigkeitsbemühungen hätten wir nie grosse Ausschreibungen gewonnen»sagte Loosli zu diesem Thema. Zum Beispiel bei Siemens oder den VW-Werken. «Fairtrade und Bio zahlt sich aus», sagte Loosli. Dabei bleibe das Geschäft mit der Gastronomie aber auch immer ein Beziehungsgeschäft, sagte Loosli. Ein weiterer Punkt sei die Digitalisierung, wo zum Beispiel in Kantinen oder in Kindergärten personalisierte Menüplanungen, oder von Ernährungsexperten entwickelte Menüvorschläge massgeschneiderte Lösungen angeboten werden könnten. In Zukunft dürften in Gastro-Betrieben die eigenen Küchen immer mehr verschwinden. Diese Lösungen könnten jederzeit in andere Länder multipliziert werden. in Russland habe man während fünf Jahren eine Partnerschaft mit Global Food gemacht. Erst danach wurde der Partner übernommen.
«Ich hätte mich nicht getraut, dies in einem Schritt zu machen»sagte Loosli. Wie die Pottwale... Die Moderatorin des Forums, Eveline Kobler, schlug vor den Buchstaben «P» aus einer anderen Optik zu betrachten. Nämlich von der EU auf die Schweiz. Dies versuchte dann auch Andreas Land, Chef des deutschen Gebäckherstellers Griesson de Beukelaer.
«Wir haben kurze Entscheidungswege»so Land. Denn die Führung der klassisch deutschen Familiengesellschaft mit 550 Millionen Euro Umsatz, wird gerade von zwei Personen erledigt. Dies laufe so seit der Gründung im Jahr 1870 als Lebkuchenhersteller. Den Erfolg der Firma sah Land darin, dass alle Mitarbeiter tief in die Materie eintauchen würden, also sich als «Pottwale» sähen. Die Konkurrenz verglich er mit «Tümmlern», die im Gegensatz zu Pottwalen, die 1500 Meter tief tauchten, nur an der Meeresoberfläche auf Nahrungssuche gehen würden. Der Gebäckhersteller hat in den letzten Jahrzehnten ein stetiges Umsatzwachstum vorweisen können. Mit Ausnahmejahren, wie dem im unvorhergesehen Brexit, wie Land ausführte. Den besten Exportmarkt hat das Unternehmen jedoch in Frankreich, gefolgt von den USA, Österreich, Grossbritannien und Italien. Die Schweiz folge erst auf Platz neun. Dies liege daran, dass in der Schweiz erstklassige Biscuitshersteller vorhanden wären, wie Land sagte.
«Der Schweizer Markt ist gut bedient»so Land. Auf die Frage, ob er in der Schweiz Biskuits herstellen möchte, sagte er, hier habe es schon exzellente Anbieter. Er würde höchstens für den Schweizer Markt hier produzieren, für den Export produziere er lieber in Deutschland. Weiter sagte er, dass der Einkauf über die Grenze hier überbetont werde. Die Schweizer Nahrungsmittelbranche würde anstelle die Dur-Töne zu betonen in Moll-Stimmung leben. Nicht gerade in Dur-Tönen beschrieb Klimaschutzbeaufttragter, Martin Frick das Weltklima.
«Wir sind in einem Raumschiff»so verglich der Direktor für die Implementierung des Pariser Abkommens die Menschheit. Wir würden momentan lernen, wie schmal der Korridor sei, auf welchem die Menschheit leben könne. Wir hätten bis jetzt nur die ersten Takte im Klimawandel erlebt. Dieser brauche nicht linear weiterzugehen, es könne nämlich plötzlich ganz schnell gehen. Zum Beispiel fange die Tundra erst jetzt an zu schmelzen, sagte Frick im Hinblick auf den damit verbundenen grossen Ausstoss an Methan und anderen schädlichen Klimagasen. Zudem würde die Landwirtschaft immer noch als heilige Kuh betrachtet. Doch liege ihr an Anteil an den Gesamtemissionen bei 24 Prozent - während Flugtransporte zum Beispiel nur gerade 3 Prozent ausmachen würden, so Frick. Wenn dann wie heute ein Drittel der Lebensmittel in der Mülltonne landen würden, dann wäre schon nur dieser Food-Waste-Anteil die drittgrösste Treibhausgasverursachungsquelle. Auch der weltweite Bodenverlust, wo mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Welt degradiert seien, beschrieb Frick als Katastrophe. Jedes Jahr würde weltweit die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz verlorengehen, so Frick. «Stellen Sie sich vor, wie die Welt aussähe, wenn die Landwirtschaft aufhören würde zu produzieren», so Frick der die Produktion von Nahrung und was auf den Tisch komme, als hochemotionales Thema beschrieb, was der Menschheit ein grosses Stück Identität gebe. Diese Zusammenhänge würden jetzt endlich begriffen und es gebe Initiative, welche landwirtschaftliche Produktionsmethoden ähnlich den Unesco-Kulturerben schützen wolle. Dabei lägen in degradierten Böden ein gewaltiges Potential. Wenn diese wieder fruchtbar gemacht werden könnten, dann könnten auch Heerscharen des riesigen Potentials an ungelernten Arbeitern beschäftigt werden. Sein Wunsch an die Schweiz wäre es, wenn ein nationaler Konsens zum Klimaschutz da wäre. Denn dann gäbe es eine kräftige Stimme mehr um die zahlreichen Herausforderungen angehen zu können. Urban Farming als Lösung Nach diesem eindrücklichen Votum für den «P» wie Planet präsentierte Andreas Gruber Mitgründer von Urban Farmers nichts weniger als die Formel zur Weltrettung. Nämlich wenn viel mehr Nahrung in Aquakulturen produziert würde. Aus einem Kilo Futter entstehe 700 Gramm Fisch. Dabei würden gleichzeitig wertvolle Nährstoffe für Gemüse produziert. Denn in zwei Liter «Fischgülle» seien die Nährstoffe gebunden und aus zwei Dritteln davon könnten 10 Kilo Tomaten produziert werden. Klar sei die Schweiz nicht auf «urbane Farmer» angewiesen, Landwirte seien weiterhin gebraucht. Doch Urban Farming könne eine wichtige Brücke zwischen Konsument und Produzent bauen mit allen Vorteilen wie diesen, dass die Food- und der Geldkreislauf wieder lokaler werde, die Luft- und die Lebensqualität in den Städten besser werde Städte so im Ranking wieder besser dastehen würden, sagte Gruber und:
«A value chain is also a chain of value»Produzenten müssten den Konsumenten auch Werte vermitteln und das Kreislaufdenken näherbringen. Dieses haben die Urban Farmers mit ihrem Aquaponik-System in Basel und Den Haag vorbildlich umgesetzt. Der Knackpunkt ist die Rentabilität: In Basel hat die Migros als Investor inzwischen den Stecker gezogen, in Den Haag ist man immer noch in den roten Zahlen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis man Geld verdiene, ist Graber überzeugt. Bereits ist die nächste Urban Farm in Dübendorf in Planung. Dort sollen auf 1000 Quadratmetern 30 Tonnen Gemüse und in den dazugehörenden Aquarien, 14 Tonnen Fisch produziert werden. in der Schweiz gebe es ein Potenzial für 50 solche Farmen, fand Graber. Seine Vision: Künftige braucht es nicht nur Landwirte, sondern auch Stadtwirte oder Dachwirte, welche die «natürliche» grüne Haut der künftigen Städte bewirtschaften. Ähnliche Vorstellungen von den Städten der Zukunft präsentierte der Zukunftsforscher Matthias Horx. Die grossen Krisen der Städte mit Entvölkerung und Kriminalität seien vorbei, was nun enstehe, sei eine Wiederbelebung der Städte mit neuen Wohnformen, kreativen Konzepte und «Re-Greening». Urban Gardening, der kleine Bruder von Urban Farming, könne natürlich nicht namhafte Mengen von Lebensmitteln produzieren, zeige aber die Sehnsucht der Menschen nach Natur und Sinnhaftigkeit. Horx lieferte auch ein paar prägnante Zukunftsprognosen: «Sitzen und Zucker sind das neue Rauchen», «in 50 Jahren kommt 70 Prozent des Fleisches aus dem Labor»,
«Insekten als Lebensmittel werden sich in der Schweiz nie durchsetzen»oder «Der Online-Handel mit Auslieferung steigt höchtens auf 20 Prozent». Schliesslich seien die Menschen auch in Zukunft nicht nur zu Hause, sondern unterwegs und auf der Suche nach Sinnlichkeit. Kritik an den Bauern Klaus Wellershof, elder Statesman unter den Schweizer Ökonomen, ging tief in die Geschichte der Ökonomie zurück und stellte das 200-jährige Konzept der komparativen Kostenvorteile von David Ricardo vor. Jedes Land solle diejenigen Dinge produzieren, die es am effizientesten produzieren könne, und andere importieren. Leider habe sich das Konzept von Ricardo noch viel zu wenig durchgesetzt, in den USA wolle Trumps mit «Make America great again» wieder inkompetitive Industrien schützen, und auch in der EU und in der Schweiz. Wellershof sparte auch nicht mit Kritik an der Schweizer Landwirtschaft, es sei stossend, dass gerade mal 150 000 in der Landwirtschaft Beschäftigte acht Millionen Konsumenten in Geiselhaft nehmen könnten. Auch die Podiumsdiskussion unter dem vagen Titel «Das Spiel mit den Produktionsfaktoren» geriet dann, weil ein Bauernvertrete fehlte, streckenweise zum Bauernbashing. Marc-André Cornu, Chef des bekannten «Roland»-Backwarenherstellers, sagte, wenn er Flûtes von der Tochterfirma in Frankreich importiere und noch Zölle und Transportkosten dazu zahle, sei es immer noch ein Drittel günstiger als die Flûte-Produktion in der Schweiz. Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses habe dazu geführt, dass nicht nur die Rohstoffkosten, sondern auch die Arbeitkosten ein Problem seien. Deshalb habe er sich 2016 entschieden, einen Teil der Produktion nach Rumänien zu verlagern. Cornu kritisierte auch, dass mit dem noch geltenden Schoggigesetz zwar ein Grossteil der Rohstoffpreisdifferenzen ausgeglichen würden, dass es ihn aber immer noch 35 000 Franken im Jahr koste. Dazu komme, dass in schlechten Erntejahren nicht genügend Weizen von guter Qualität vorhanden sei. Cornu war sich mit den beiden anderen Podiumsteilnehmern, SP-Nationalrat Beat Jans und Avenir Suisse-Chef Peter Grünenfelder, darüber einig, dass weitere Grenzöffnungen für die Landwirtschaft dringend nötig seien. Jans erklärte, die Kostendifferenzen gegenüber dem Ausland würden wachsen, pro Haushalt koste der Grenzschutz 1000 Franken im Jahr. Grünenfelder sagte, er erhoffe sich nun entscheidende Reformschritte bei der Agrarpolitik, derzeit würden die bäuerlichen Einkommen zu zwei Dritteln durch die Steuerzahler alimentiert, das sei nicht haltbar.