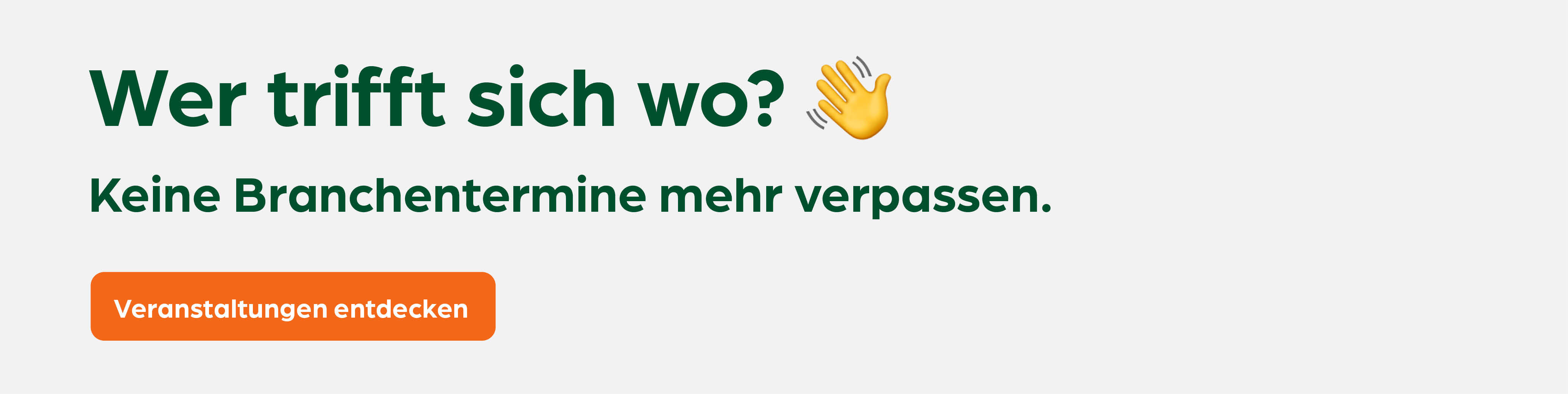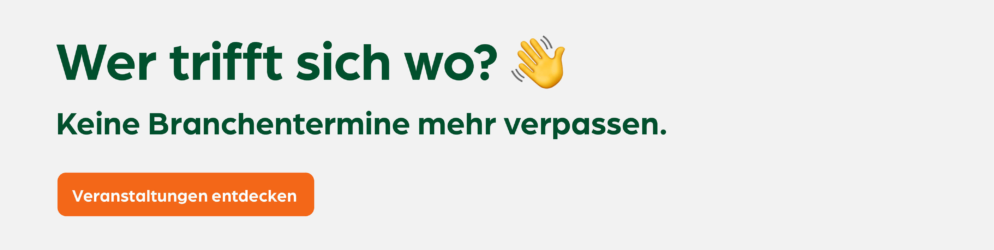Klimapolitik über Kostenwahrheit brauche es auch in der Landwirtschaft, findet Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger. (Symbolbild zVg)
Was braucht es für eine effiziente Klimapolitik? «Kostenwahrheit für alle», findet Reiner Eichenberger, Professor für Wirtschafts- und Finanzpolitik an der Universität Freiburg. «Jeder soll den vollen Preis für sein emittiertes CO2 bezahlen – ohne Ausnahmen», sagte Eichenberger in seinem Eröffnungsreferat am Online-Symposium «Passion for Food - Convenience und Nachhaltigkeit im Einklang» der Berner Hochschule für Forst-, Agrar- und Lebensmittelwisssenschaften (HAFL) vom 9. Juni. Eine solche CO2-Abgabe sei für die Schweizer Wirtschaft «problemlos tragbar» und würde auch nicht zu grossen Produktionsverlagerungen führen, ist Eichenberger überzeugt.
Die Weltbank veranschlagt den Preis für die künftigen Klimaschäden von CO2 heute mit 40 bis 80 Dollar pro Tonne. Für die Schweiz mit einem jährlichen Ausstoss von 46 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten würde das eine CO2-Abgabe von 1,3 bis 3,3 Milliarden Franken bedeuten, rechnete Eichenberger vor. «Ein Klacks», verglichen mit den 23 Milliarden Mehrwertsteuer oder dem jährlichen Gesamtsteueraufkommen von rund 145 Milliarden Franken. Ausserdem brauche es so keine Subventionen mehr für erneuerbare Energien. Unter dem Strich bekäme man so viel mehr Klimaschutz fürs Geld als mit der heutigen Politik, so Eichenberger.
Kostenwahrheit sei auch der richtige Weg für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion, sagte Eichenberger. Aber wäre eine CO2-Steuer für die Schweizer Landwirtschaft überhaupt tragbar? Die Landwirtschaft trägt in der Schweiz nur 0,6 Prozent zur gesamten Wertschöpfung bei, ist aber für 14 Prozent der Treibhausgase (gemessen in CO2-Äquivalenten) verantwortlich. Eine CO2-Abgabe mit 40 bis 80 Dollar pro Tonne würde diesen Sektor jährlich mit 209 bis 465 Millionen Franken belasten, rechnete Eichenberger vor. Heruntergerechnet auf einen Liter Milch würde eine solche CO2-Steuer Mehrkosten von 5,7 bis 11,5 Rappen bedeuten, für ein Kilogramm Rindfleisch wären es 45 bis 90 Rappen. «Das wäre weitgehend problemlos möglich», sagte Eichenberger. Zumal die Alternativen deutlich schlechter seien. Denn gerade in der Lebensmittelproduktion sei die Berechnung der Emissionen entlang der ganzen Wertschöpfungskette hoch komplex. «Entsprechend ist die Gefahr von Über- oder Falschregulierung durch die Politik besonders gross.»
Weniger Fleisch, weniger Food Waste
Unsere Ernährung belastet das Klima. 2100 Kilogramm CO2-Äquivalente beträgt der Klimafussbadruck der Ernährung in der Schweiz pro Kopf und Jahr. «Wollen wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens erreichen, muss der Fussabdruck bis 2050 auf 600 bis 800 Kilogramm sinken», sagte Matthias Meier, Dozent für nachhaltige Lebensmittelwirtschaft an der HAFL, in seinem Referat. Dazu sei einerseits ein Ausstieg aus der fossilen Energie nötig und eine Reduktion der Lebensmittelverschwendung. Andererseits brauche es ein verändertes Ernährungsverhalten, nämlich weniger tierische Produkte. «Die machen heute 50 Prozent des Klimafussabdrucks unserer Ernährung aus», so Meier. Auch die Reduktion der Energiezufuhr könnte dem Klima helfen. Heute nehmen wir im Schnitt 3000 Kalorien pro Tag zu uns. «Den meisten würden auch 2500 Kalorien reichen.»
Wie eine ressourcenschonende Produktion in der Praxis aussehen kann, zeigten drei Referierende aus der Lebensmittel- und Verpackungsbranche. Eine Reduktion des Fleischkonsums durch leckere und gesunde Fleischalternativen, das ist die Mission des jungen Schweizer Unternehmens Planted Foods. Seine Poulet-Alternative auf Erbsenbasis, hergestellt mit Nassextrusion, gibt’s schon seit längerem in den Supermärkten. Heute produziert Planted im zürcherischen Kempthal auch eine Schweinefleisch- und Kebab-Alternative und bringt demnächst ein pflanzliches Schnitzel auf den Markt. Für ein Kilogramm Pouletalternative brauche es nur halb so viel Wasser und halb so viel Land wie für das tierische Produkt, die Treibhausgasemissionen seien zwei Drittel kleiner, sagte Elisabeth Beerli von Planted. Ausserdem verwende man für die Pulled-Schweinefleischalternative auch Presskuchen, die bei der Sonnenblumenölproduktion als Nebenprodukt anfallen.
Flaschen aus Zuckerrohr
Aus Nebenprodukten der Lebensmittelproduktion nachhaltige Verpackungen herstellen? Das macht das Westschweizer Unternehmen Vegipack. Aktuell produziert das Unternehmen Flaschen aus Bagasse, den faserigen Überresten, die nach dem Auspressen von Zuckerrohr übrigbleiben. Künftig möchte Vegipack die Nebenprodukte der Schweizer Lebensmittelindustrie als Rohstoffe für Verpackungen nutzen, wie CEO Massimo Caputo sagte. Denkbar wäre etwa, aus den Nussschalen, die bei der Ölproduktion anfallen, Flaschen fürs Nussöl herzustellen.
Zweite Chance für altes Brot
«Frisch von gestern»: Unter diesem Motto sammelt die 2013 gegründete Äss-Bar täglich bei 200 Bäckerfilialen Brot und Backwaren, Müesli, Salate oder Suppen vom Vortag ein und verkauft sie in den eigenen Läden zum halben Preis weiter. Pro Jahr könne die Äss-Bar so 800 Tonnen Lebensmittel verkaufen, die sonst im Biogas oder Abfall gelandet wären, sagte Co-Founder und Geschäftsführer Sandro Furnari. Die Kunden kämen aus allen Gesellschaftsschichten: Manche schätzten den günstigen Preis, anderen kauften bewusst bei der Äss-Bar ein, um Food Waste zu vermeiden. Man zahle den Bäckereien eine Entschädigung für die übernommenen Waren, sagte Furnari. «Aber die Entschädigung ist nicht so hoch, dass sie einen Anreiz zur Überproduktion schafft.» Die Äss-Bar hat auch Upcycling-Projekte entwickelt: Zusammen mit einer Brauerei brachte sie ein Bier aus altem Brot auf den Markt und eine Schoggimanufaktur produziert Dragées mit Brotbrösmeli.
Knackpunkt letzte Meile
Corona hat dem Online-Lebensmittelhandel auch in der Schweiz Schub verliehen. Doch wie nachhaltig ist es eigentlich, sich Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen, statt selber im Laden einzukaufen? Das hänge stark von der Lieferkette und dem Einkaufsverhalten der Konsumenten ab, sagte HAFL-Dozent Matthias Meier. Laut einer aktuellen Simulationsstudie aus Grossbritannien verursache der Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs via reinen Onlinehandel meistens die höchsten CO2-Emissionen, so Meier. Senken könne man den Klimafussabdruck durch die Elektrifizierung der Transporte auf der letzten Meile. Die Konsumenten sollten ausserdem ihre Einkäufe möglichst bei einem Anbieter machen und nicht auf mehrere Anbieter aufteilen. Ganz wichtig, so Meier: Der Online-Handel werde insgesamt nur dann zur Reduktion der CO2-Emmissionen beitragen, wenn dadurch die traditionellen Shoppingtrips reduziert würden.
Farmy als «Corona-Gewinner»
Wie sieht es in der Praxis aus? Mit eigens entwickelten Elektromobilen liefert seit anderthalb Jahren der Online-Supermarkt Farmy die bestellte Ware aus, zumindest in der Kernzone rund um die Hubs in Zürich und Lausanne. In der übrigen Schweiz übernehmen Autokuriere bzw. ein externes Kühllogistikunternehmen die Auslieferung. Man habe auch eine Farmy-Lieferbox entwickelt, die sich bis zu neun Mal wiederverwenden lasse, sagte Farmy-Mitinhaber Thomas Zimmermann. Das Projekt habe man aber vorübergehend gestoppt, weil Teile der Kundschaft wegen Corona hygienische Bedenken gehabt hätten.
«Wir sind Corona-Gewinner», sagte Zimmermann. Der Lockdown brachte Farmy 20'000 Neukunden, der Umsatz schnellte von 10 Millionen Franken im Jahr 2019 auf 26 Millionen hoch. «Für dieses Jahr rechnen wir mit 35 bis 40 Millionen Franken.» Das 2014 gegründete Unternehmen ist heute der drittgrösste Online-Lebensmittelhändler der Schweiz und bringt Frischeprodukte wie Früchte und Gemüse in 15 Stunden vom Produzenten zum Konsumenten. «So schnell ist niemand mit frischen Lebensmitteln», sagte Zimmermann. Im Detailhandel dauere es vier bis fünf Tage, bis Ware vom Feld im Regal stehe.
Dispobox schlägt Kartonschachtel
Wie komplex es sein kann, Lebensmittel konsequent ökologisch zu versenden, veranschaulichte Corinne Mahler. Sie ist bei dem 2011 gegründeten Bio-Onlineshop mahlerundco.ch zuständig für Marketing und Kommunikation. Neben 150 Eigenmarken-Produkten verkauft der Shop 2500 Bio-Produkte beliebter Marken und bietet auch Gemüse- und Früchteabos an, 1200 Abonnenten nutzen diese sogenannte Bio Box. «90 Prozent der Kunden möchten eine Mehrwegbox und Plastik ist der grösste Störfaktor», fasste Mahler die Ergebnisse einer Umfrage unter 10'000 Kunden zusammen.
Doch welches Verpackungsmaterial ist am nachhaltigsten? 40 Materialien testete das Unternehmen mit der Methode des Umweltbelastungspunktes, der den ganzen Lebenszyklus berücksichtigt. Weitere Kriterien waren die Wirtschaftlichkeit, die Umsetzbarkeit, die Akzeptanz bei den Kunden, das Image und der Platzbedarf im Lager. Das Resultat? «Produkte, die als besonders ökologisch angepriesen wurden, erwiesen sich meist als Flop», so Mahler. Als vorteilhaft hätten sich ein HDPE-Plastikbeutel aus 85 Prozent Zuckerrohr erwiesen oder Ausschussmaterial aus Druckereien als Stopfmaterial. Doch Plastikverzicht ist nicht ohne. So verpackt die Firma ihre Eigenprodukte wie Nüsse oder Trockenfrüchte nach wie vor in herkömmliche OPP-Beutel – denn diese lassen sich, im Gegensatz zu vielen nachhaltigen Materialien, verschweissen, wie Mahler sagte.
Beim Versand setzt mahlerundco.ch zunehmend auf die Dispoboxen der Post. Diese Kunststoffboxen lassen sich bis zu 100-mal verwenden. Danach werden sie eingeschmolzen, aus dem Granulat entstehen neue Boxen. «Die Dispobox ist deutlich ökologischer als eine Kartonschachtel», so Mahler.