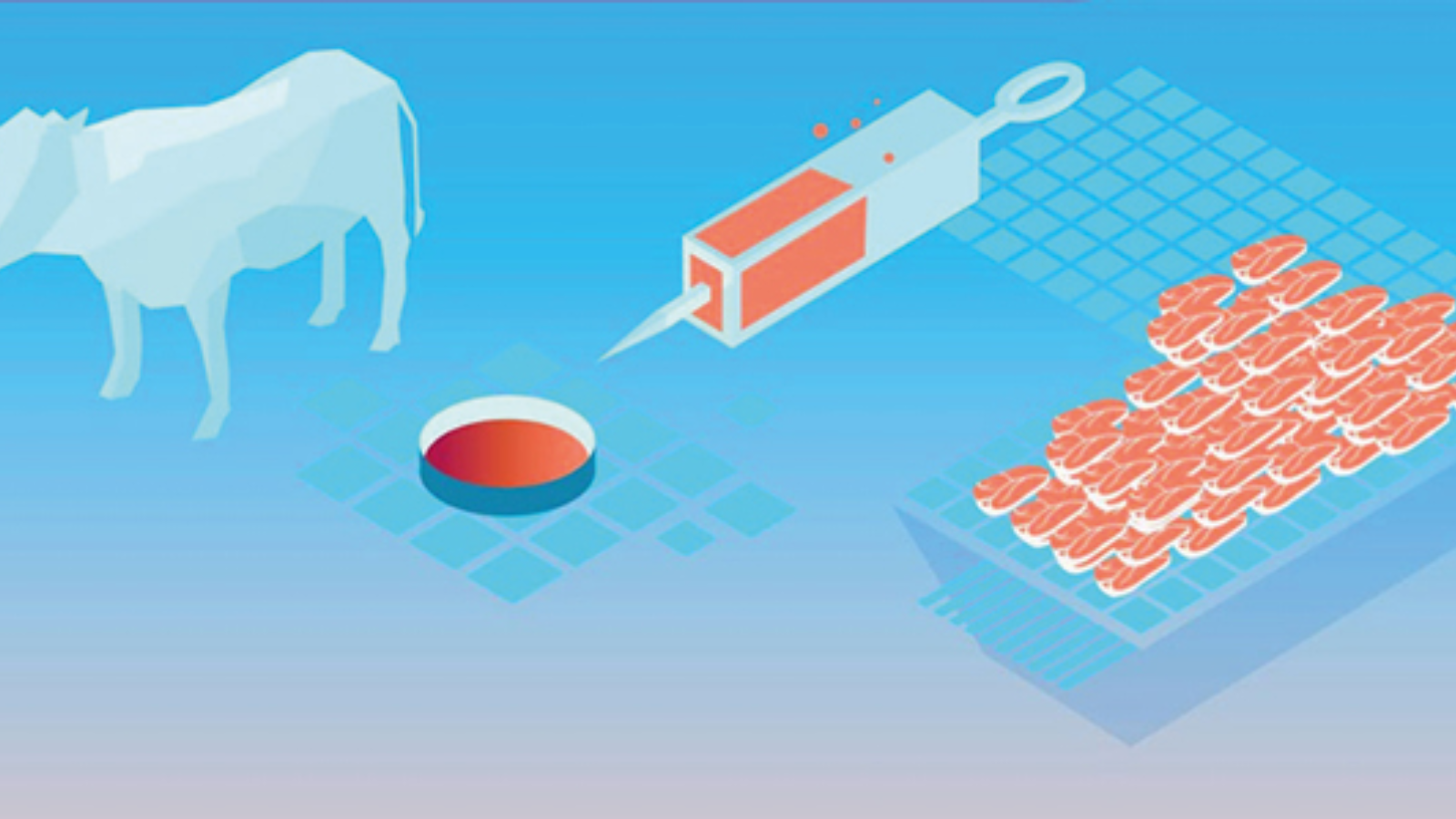22.01.2024


Grenzen des Nutzens von Freihandelsabkommen
Der Bund führt derzeit Verhandlungen mit Malaysia über ein Freihandelsabkommen. Dabei geht es auch um Erleichterungen für das umstrittene Palmöl. Solche würden die Schweizer Ölsaatenindustrie bedrohen.
Malaysia ist ein interessanter Exportmarkt: Das Land belegt neben China, Indien und den Philippinen einen Spitzenplatz unter den beliebtesten asiatischen Exportländern aus Sicht der Schweiz. Die Gründe sind unter anderem das immer noch hohe Wachstum in dieser Region, das steigende Pro-Kopf-Einkommen und die ansehnliche Aufwertung der Landeswährung gegenüber dem Schweizerfranken.Schweizer Firmen möchten von solchen attraktiven Ausgangslagen gerade in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, wie es momentan herrscht, verständlicherweise profitieren: Die Erschliessung neuer Absatzmärkte im Export ist einer der Schlüssel zum Erhalt oder gar Ausbau des wirtschaftlichen Erfolges. Laut einer Umfrage der Exportförderorganisation Switzerland Global Enterprise im letzten Quartal 2015 wollen von den über 200 befragten Unternehmen denn auch 54 Prozent im nächsten Halbjahr in die Region Asien-Pazifik exportieren. Dass der Bund da Verhandlungen mit Malaysia, Indonesien und den Philippinen führt, ist deshalb grundsätzlich sehr zu begrüssen. Nur: Solche Abkommen sind nicht gratis zu haben. «Do ut des» lautet auch hier die Verhandlungsmaxime. Wenn der Schweizer Exportwirtschaft der Zugang auf den malaiischen Markt erleichtert werden soll, muss das umgekehrt auch gelten. Malaysia zählt unter seinen Exportgütern nebst Öl und Flüssiggas vor allem Palmöl. Das Land ist deshalb darauf angewiesen, in diesem Bereich Handelserleichterungen zu erhalten, die im Wesentlichen in einem Abbau der Grenzabgaben bestehen. Das ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Palmöl ist auf Grund der Methoden seines Anbaus nicht unumstritten. Auch die Einführung des RSPO-Standards hat die Gemüter nicht restlos zu beruhigen vermocht. Frankreich hat jüngst beschlossen, eine Sondersteuer auf Palmölprodukten zu erheben, Norwegen prüft offenbar ein totales Verbot des Einsatzes von Palmöl in Lebensmitteln.
Ölsaatenindustrie käme unter Druck
Abgesehen von diesen oftmals sehr emotional und weniger rational geführten Diskussionen hätten grössere Zugeständnisse bei den Importzöllen auf Palmöl aber ganz praktische Folgen in der Schweiz: Die einheimische Ölsaatenindustrie käme unter starken Druck, weil im Bereich der Frittiermedien, wo kein «Swissness-Bonus» geltend gemacht werden kann, das schweizerische HOLL-Rapsöl preislich stark durch das Palmöl konkurrenziert werden dürfte. Aber auch die übrigen Speiseöle gerieten wohl stark in Bedrängnis, weil Palmöl als internationaler Benchmark für die Preisentwicklung gilt. Dies könnte letztlich die Anbaubereitschaft in der Schweiz gefährden. Das wäre auch deshalb schade, weil der Rapsanbau eines der Erfolgsbeispiele dafür ist, wie eine Branche sich nach dem Rückzug des Bundes von den Leistungsaufträgen durch grosse Anstrengungen erfolgreich entwickeln kann. Rapsanbau in der Schweiz ist eine absolute Erfolgsstory und trägt durch ein privat getragenes Umlagerungssystem innerhalb der gesamten Branche auch zum Erhalt des Sonnenblumenanbaus bei. Weiter kämen auch die least developped countries als Palmöl-Herkunftsländer unter grossen Druck, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, weil der Bund gerade diese Länder durch die Gestaltung der Grenzabgaben in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung explizit fördern will. Denkt man zudem noch an die agrarpolitischen Ziele der Schweiz in der gegenwärtigen Ausrichtung der Agrarpolitik (Förderung des Ackerbaus und Möglichkeit von kantonal auszuschüttenden Beiträgen für eine farbige Landschaft, d.h. für gelb blühende Raps- und Sonnenblumenfelder), so scheint die skizzierte Entwicklung nicht sehr kohärent zu sein. Es ist verständlich, dass die Exportindustrie Märkte wie Malaysia erschliessen will, ja muss. Dass der Bund dabei Hilfe leistet, ist wie eingangs erwähnt sehr zu begrüssen. In solchen Fällen ist aber vorgängig eine Grenznutzenrechnung anzustellen, die aufzeigt, welche Risiken man bei Abschluss eines Abkommens in Kauf nimmt. Diese müssen in die Gesamtplanung der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes eingebettet werden können. Es macht keinen Sinn, auf der einen Seite Geld auszugeben für die Förderung von Kulturen, um sie auf der anderen Seite mit einem Freihandelsabkommen in ihrer Existenz zu gefährden. Die Ölsaaten sind hier nur ein Beispiel; gleiche Überlegungen muss man sich beim Anbau von Zuckerrüben oder Futtergetreide in der Schweiz machen. Letztlich braucht es in diesen Fällen vorab einen klaren politischen Entscheid, in welche Richtung die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes gehen soll. Sonst riskiert man, ein ausgehandeltes Abkommen im Parlament nicht durchzubringen, was gerade mit asiatischen Partnern ungeahnte Folgen haben kann. Urs Reinhard, Co-Geschäftsführer Föderation der schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien fial
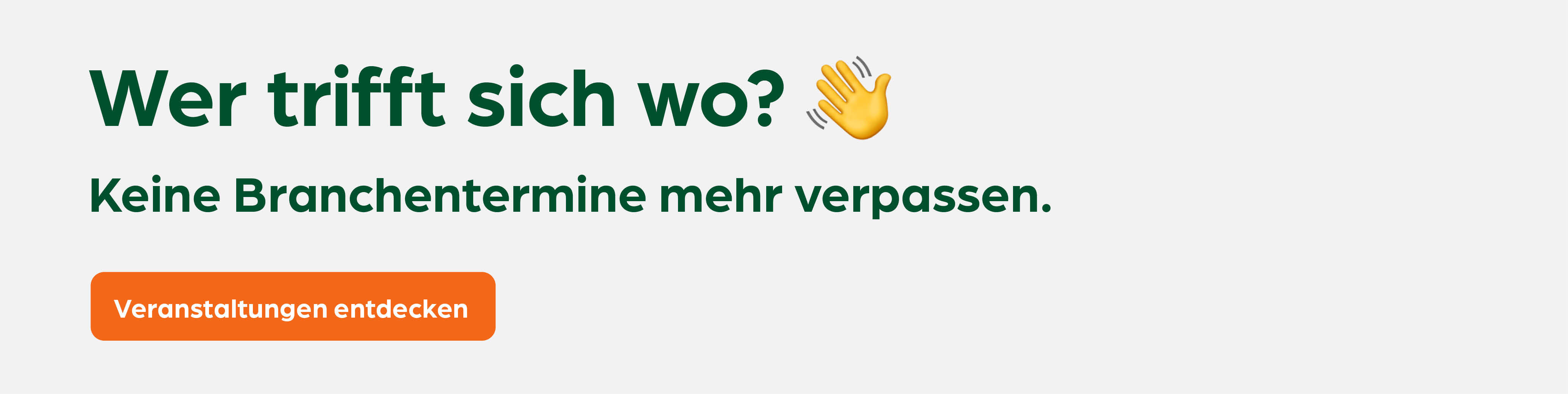

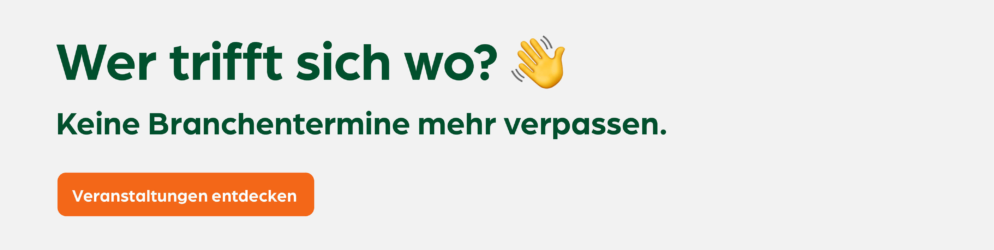
Ähnliche Beiträge
29.03.2023
02.11.2022