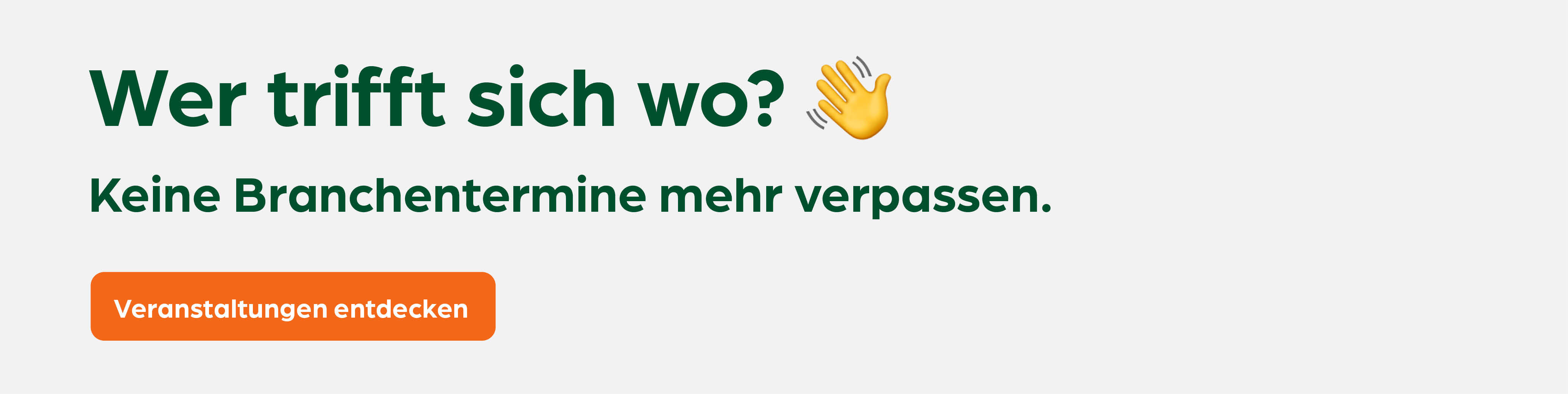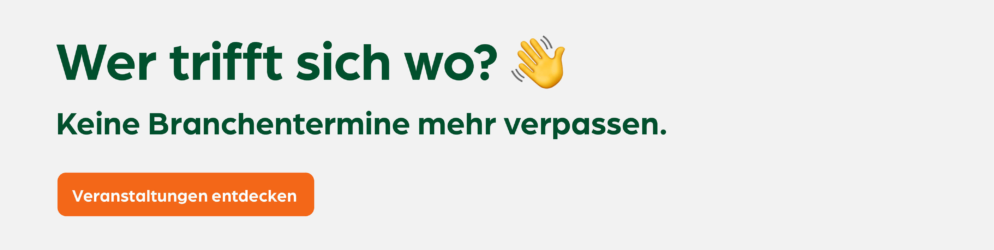«Zielkonflikte muss man akzeptieren, quantifizieren und lösen.» Robert Finger, Professor für Agrarökonomie an der ETH Zürich. (Stephan Moser)
Darüber, dass die Land- und Ernährungswirtschaft nachhaltiger werden muss, ist man sich schnell einig. Künftig müssen mehr Lebensmittel für eine wachsende Bevölkerung produziert werden, aber mit kleinerem ökologischem Fussabdruck. Aber wie genau? Viele Zielkonflikte pflastern den Weg: Weniger Pflanzenschutz zum Beispiel bedeutet gesündere Gewässer, aber tiefere Erträge, also weniger Einkommen für die Bauern. Mehr Tierwohl bedeutet höhere Kosten, also teurere Produkte für die Konsumenten. Mehr Tierwohl in Form von mehr Auslauf bedeutet mehr Treibhausgas-Emissionen, ist also schlecht fürs Klima.
«Zielkonflikte muss man akzeptieren, quantifizieren und lösen», sagte Robert Finger, Professor für Agrarökonomie an der ETH Zürich, an der Fachtagung «Brennpunkt Nahrung» vom 23. November in Luzern. Der schlimmste Fehler, der passieren könne, sei eine Art «Whataboutism», wenn nur noch Zielkonflikte und Hindernisse statt Lösungswege besprochen würden.
Es gebe drei Wege, Zielkonflikte anzugehen, fuhr Finger fort. Mit Effizienz, etwa mit Precision Farming, bei dem weniger Pflanzenschutzmittel für gleich hohe Erträge verbraucht werden. Mit Substitution, etwa mit biologischen Bekämpfungsstrategien anstelle von Pflanzenschutz. Oder mit Redesign: Indem mit mehr Diversität auf den Feldern weniger Pflanzenschutz benötigt wird, oder indem die Produktion etwa von Gemüse und Kräutern ganz von der Fläche und in Hallen verlegt wird. Oder indem mit neuen Pflanzenzüchtungsmethoden Sorten gezüchtet werden, die weniger krankheitsanfällig sind.
«Es braucht alle drei Methoden, Effizienz, Substitution und Redesign, um den Agrar- und Ernährungssektor zukunftsfähig zu machen», sagte Finger. Und zwar nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch bei den nachgelagerten Stufen. Effizienz könne hier bedeuten, dass weniger Food Waste produziert werde, Substitution, dass Fleisch durch pflanzliche Proteine ersetzt werde und Redesign, dass neue Ernährungsmuster sich durchsetzen. Dadurch entstünden auch wieder neue Zielkonflikte, aber diese gelte es, mit einer holistischen und langfristigen Perspektive auszuhalten.
Um den Wandel zu beschleunigen, müsse die Politik einen Schritt vorausgehen, fand Finger, und klare Ziele definieren und einfordern. Statt Massnahmen zu definieren, die von der Landwirtschaft oder von Verarbeitern eingehalten werden müssen, sollte die Politik lediglich die Erreichung von Zielen honorieren und die Nichterreichung bestrafen. Der Weg zum Ziel solle in der Verantwortung der Akteure liegen. Wichtig sei auch, dass man die Digitalisierung, die modernen Pflanzenzüchtungsmethoden oder Innovationen aus der Industrie als Chance betrachte und nicht einfach ablehne.
Wie viel Nachhaltigkeit ist international erwünscht?
Mit Nachhaltigkeit und Handel befasste sich Elisabeth Bürgi Bonanoni, Professorin am Centre for Development and Environment an der Universität Bern. Sie betonte, was seit ein paar Jahren in der Bundesverfassung festgehalten ist: Dass grenzüberschreitende Handelsbeziehungen zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen sollen. Was die Schweiz importiere und zu welchen Bedingungen sie importiere, habe Auswirkungen auf andere Länder, sagte Bürgi Bonanomi. Hier könne die öffentliche Hand Regeln erlassen, um die Qualität zu sichern, um Vorgaben für Kennzeichnungen zu machen, Gleichwertigkeitsanerkennungen einführen, Importe von nachhaltigen Produkten durch Importkontingente steuern oder staatliche Gelder für nachhaltige Ziele bezahlen.
Welche Art von nachhaltigen Zielen WTO-konform sind, sei allerdings eine schwierige Frage, sagte Bürgi Bonanomi. International anerkannt seien Klimaziele, die Themen Biodiversität oder Menschenrechte. Das Thema Tierwohl sei international eher unterentwickelt.
Die EU-Kommission plant, Entwaldung als Kriterium für Importe zu definieren und entsprechende Produktimporte zu verbieten. Davon wären etwa Rinder, Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja und Holz betroffen. Bürgi Bonanomi glaubt aber, dass die EU damit auf internationaler Ebene auflaufen wird. Malaysia und Indonesien hätten bereits vor der WTO dagegen geklagt, etwa, weil Rapsöl und Palmöl nicht gleich behandelt würden.
Landwirtschaft am Limit
Sandige Böden, kaum Niederschlag: In Brandenburg ist die Landwirtschaft schon jetzt am Limit, der Klimawandel könnte das endgültige Aus bedeuten. «Wenn wir hier auch künftig Lebensmittel produzieren wollen, können wir nicht weiter machen wie bisher», sagte Landwirt Benedikt Bösel in einer Liveschaltung aus der deutschen Provinz. Der Investmentbanker übernahm Ende 2016 den 3000-Hektaren-Hof seiner Eltern im brandenburgischen Alt Madlitz. Seither versucht Bösel, über multifunktionale Landnutzung, ein ganzheitliches Weidemanagement und Agroforstsysteme, Boden und Humus aufzubauen und seine Böden vor Erosion zu schützen. Seine 2000 Hektaren Kiefernmonokulturplantagen baut er in klimaresilientere und diversere Wälder um. Das alles soll nicht nur das Überleben seines eigenen Betriebes sichern. Über eine eigene Stiftung will er das Wissen über multifunktionale Landnutzungssysteme auch allgemein zugänglich machen.
Transparenz im Supermarktregal
Wie bringt man Konsumentinnen und Konsumenten dazu, bewusst nachhaltig einzukaufen? «Mit konsequenter Transparenz», ist Christine Zwahlen, Projektleiterin Nachhaltigkeit bei der Migros, überzeugt. Diese Transparenz will die Migros ihrer Kundschaft mit dem M-Check geben, der mit bis zu fünf Sternen anzeigt, wie klimaverträglich, tierfreundlich und nachhaltig verpackt ein Lebensmittel ist. Der M-Check macht auch Zielkonflikte sichtbar: So ist etwa ein Bio-Pouletbrüstli zwar tierfreundlicher als ein konventionell produziertes, schneidet dafür aber in der Klimabilanz schlechter ab. Ob und wie der M-Check das Kaufverhalten tatsächlich beeinflusse, lasse sich bislang nur schwer nachweisen, so Zwahlen. Die Methodologie des M-Check steht laut Zwahlen übrigens auch anderen Händlern und Markenartikelherstellern offen.
Kritisch sieht den M-Check Nadine Masshardt, Präsidentin des Konsumentenschutzes (SKS). «Mehr Transparenz ist wünschenswert, aber dass jeder Anbieter sein eigenes System entwickelt, ist nicht im Interesse der Konsumenten», sagte sie. Viel besser wäre es, wenn sich alle Händler auf ein unabhängiges System einigen könnten, wie etwa den Eco-Score, den die Migros-Konkurrentin Coop auf ihren Eigenmarken einführt. Masshardt forderte ausserdem eine faire Preispolitik, eine verbesserte Herkunftsangabe für Zutaten von verarbeiteten Produkten, ein Nutri-Score-Obligatorium für alle Kinderprodukte und eine gesetzliche Regelung für die Verwendung von Begriffen wie «natürlich», «nachhaltig» oder «aus verantwortungsvoller Produktion». Die Hersteller würden diese schwammigen, aber bei den Konsumenten positiv besetzten Begriffe, für «Greenwashing» nutzen.
Der Weltuntergang motiviert nicht
Wir alle wissen, dass wir etwas ändern müssen, aber wir tun es nicht. Wie lässt sich die Kluft zwischen Wissen und Handeln überwinden? Wie können Menschen motiviert werden, eine gemeinsame Transformation anzugehen? Dazu forscht Hans Rusinek, der Firmen und Institutionen in Transformationsprozessen berät. Für ihn sind fünf Punkte entscheidend. 1. Radikale Klarheit ist der Schlüssel für Wandel. Ohne gemeinsamen, klaren Beschluss, was sich ändern soll, könne Wandel nicht gelingen. 2. «Um Menschen zu Veränderung zu bringen, muss man betonen, was erhalten wird.» Fordere eine Umweltaktivistin ökologisches Umdenken, erzeuge das Stress. «Betont sie aber, dass es darum geht, auch in Zukunft noch mit den Enkeln im Wald spazieren zu können, sieht die Sache anders aus.» 3. Anti-Apokalyptik: Wer den Weltuntergang predige, motiviere nicht zum Handeln. Im Gegenteil: «Wenn die Welt untergeht, lohnt es sich ja gar nicht mehr, sie zu retten.» 4. Lustvolle Annäherungsziele: Es gehe darum, Veränderung nicht als Vermeidung zu verstehen, sondern daraus eine positive Sehnsucht zu machen. 5. Das Einüben neuer Praktiken – zum Beispiel, dass ein Chef im Rahmen eines Transformationsprozesses den Angestellten das Du anbiete.
«Einer spricht, 99 hören zu»
Viele Menschen verbringen Stunden pro Tag auf Youtube oder TikTok – besonders hoch ist die Nutzung übrigends während der Arbeitszeit. Aber nur etwa ein Prozent der User schaffen auch Inhalte für die sozialen Medien. «Einer spricht, 99 hören zu», so fasste es Digitalberater Roger Liam Basler de Roca zusammen. Er ermunterte die anwesenden Führungskräfte der Ernährungsbranche, die sozialen Medien aktiv zu bespielen. «Sie haben 100 Prozent Sichtbarkeit, wenn sie heute was auf Social Media posten.» Er riet davon ab, die Beackerung der sozialen Medien an Influencer auszuladen. «Machen Sie es selber.» Wenn es Zeit und Kreativität mangle, gebe es heute schon gute Tools, die mittels künstlicher Intelligenz in Sekundenschnelle gute Texte für Posts schreibe.
90 Millionen Tonnen CO2
Mitten in grossen Transformationsprozesse stecken die beiden Grosskonzerne Syngenta und Nestlé. Mit dem Good Growth Plan will der Agroriese Syngenta eine ressourceneffiziente, nachhaltige und klimaresiliente Landwirtschaft fördern. Zentral dafür sind Daten, wie Elisabeth Fischer, Leiterin Nachhaltigkeitsstrategie und Transformation bei Syngenta, erklärte. Um diese Daten zu sammeln, geht Syngenta auch ungewöhnliche Wege. Zusammen mit Partnern hat der Konzern ein zigarettenschachtelgrosses Gerät entwickelt, das mit optischen und akustischen Sensoren automatisch die Insekten und Vögel identifiziert und zählt, die auf einem Feld vorkommen. Nächstes Jahr soll das Gerät auf den Markt kommen und es Bauern auf einfache Art erlauben, die Biodiversität ihrer Anbauflächen zu messen.
Der Lebensmittelmulti Nestlé will bis 2050 seine Klimagasemissionen auf Netto Null reduzieren – und zwar entlang der ganzen Wertschöpfungskette vom Acker auf den Teller. Dabei geht es um über 90 Millionen Tonnen CO2 – mehr als doppelt so viel wie die Schweiz pro Jahr ausstösst. Eine Herausforderung für Nestlé: Rund 70 Prozent der Emissionen entstehen bei den Rohstoffen wie Milch, Kaffee und Kakao. Heike Steiling, Forschungsleiterin des Nestlé-Campus in Konolfingen, zeigte auf, mit welchen Massnahmen Nestlé sein Klimaziel erreichen will: Angefangen mit neuen Pflanzenzüchtungen, über veränderte Rezepturen, Prozesstechnologie, Verpackungsdesign bis hin zu neuen, pflanzlichen Produkten, wie etwa einer veganen Thunfischalternative. Schon kleine Massnahmen können dabei einschenken: So ist etwa der Klimafussabdruck des veganen Kit-Kats 18 Prozent tiefer als beim konventionellen Riegel – einzig durch das Ersetzen der Milch durch einen Reisdrink. Eine neu gezüchtete Robustakaffeepflanze mit 50 Prozent mehr Ertrag auf gleicher Fläche reduziert den Klimafussabdruck einer einzelnen Tasse Kaffee um 30 Prozent.
Ein Höhepunkt der von der der SRF-Journalistin Eveline Kobler souverän moderierten Tagung waren die Instant-Protokolle der Satirikerin Patti Basler. Begleitet von Philipp Kuhn am Flügel, brachte sie die Erkenntnisse des Tages mit satirischer Schärfe, verspieltem Wortwitz und poetischer Wucht auf den Punkt.
______________________________________________________
Ein Start-up in der Firma
Martin Henck, CEO von Hilcona, erklärte in Luzern die Entstehung des firmeneigenen Fleischersatz-Start-ups «The Green Mountain». Hilcona wollte im Markt für Fleischersatz tätig werden und habe als etabliertes Unternehmen etablierte Strukturen und Prozesse und einen Kundenstamm, sagte Henck. Ein Start-up hingegen sei flexibel, fokussiert, könne ein neues Produkt und die dazugehörige Geschichte gut vermitteln. Deshalb habe man sich für den Mittelweg entschieden - ein Start-up im Unternehmen. Die Realisierung der Marke sei in nur zwei Wochen geschehen, die Lancierung sei mitten in der Corona-Zeit erfolgt. «Das war gar nicht so schlecht, es hat uns Aufmerksamkeit gebracht.»
Das Team von «The Green Mountain» denke sehr unternehmerisch, es sei intrinsisch motiviert und schnell. Das führe teilweise auch zu Spannungen mit der Mutterfirma, aber daraus könne man viel lernen, sagte Henck.