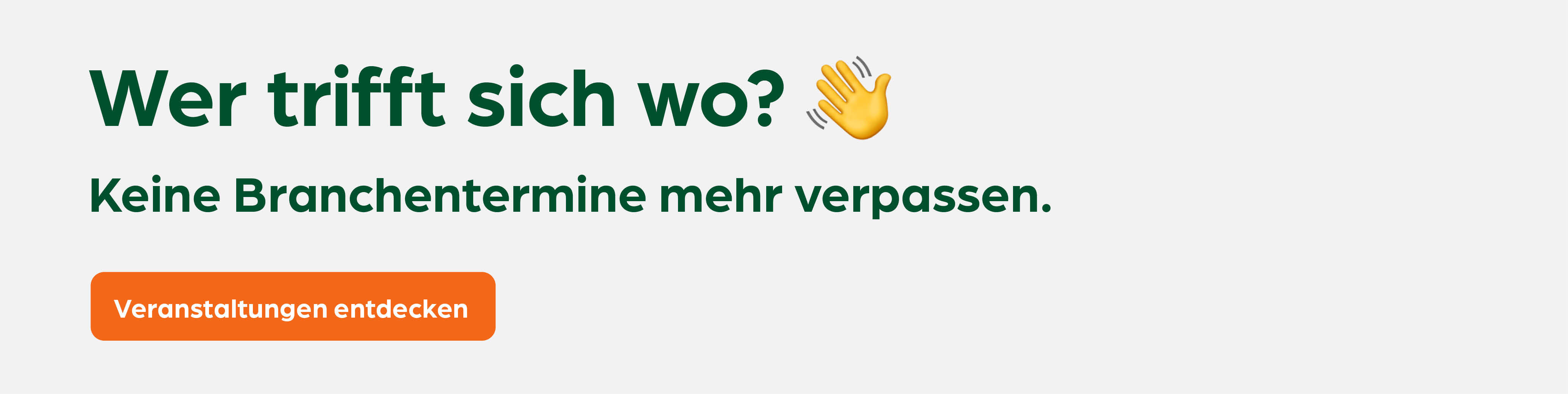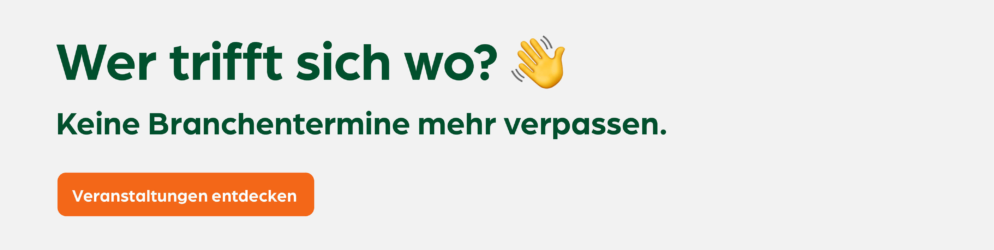Die EU findet sich in einem Umfeld geopolitischer Spannungen wieder. Mit ihrer «Strategischen Autonomie» will sie deshalb militärisch, politisch und wirtschaftlich unabhängiger von den USA und China werden. Am Mittwoch wird die EU-Kommission Vorschläge dazu präsentieren. Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lassen erahnen, in welche Richtung es gehen könnte: Am World Economic Forum (WEF) in Davon brachte sie einen «Souveränitätsfonds» ins Spiel.
Der Vorschlag ist aber auch als Antwort der EU auf den «Inflation Reduction Act» (IRA) der USA gedacht. Mit 369 Milliarden Dollar wollen die USA die hohe Inflation bekämpfen und den Klimaschutz vorantreiben. Die EU fürchtet, dass deswegen Unternehmen aus der EU abwandern könnten. Sie selbst lancierte jedoch 2021 einen 750-Milliarden-schweren Wiederaufbaufonds, mit dem die Wirtschaft in der EU nach der Corona-Krise gestärkt werden soll.
Was das für Schweiz bedeutet
Wenn alle rund herum ihre Industrieren mit staatlichen Geldern unterstützten, dann dürfte die Schweiz unter Druck kommen und gezwungen sein, dies ebenfalls zu tun. «Unter keinen Umständen soll sie das tun», antwortet Brunetti auf eine Frage der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Die Idee einer staatlichen Lenkung der Innovation, die die USA mit dem IRA und die EU mit ihren Fonds offensichtlich anstreben, kommt direkt aus dem ökonomischen Giftschrank.»
Es sei nicht Aufgabe des Staates, Industriezweige oder einzelne Unternehmen zu fördern. «Der Staat weiss nicht besser als Unternehmer, die ihr eigenes Geld investieren und im Gegensatz zu staatlichen Stellen im Wettbewerb stehen, welche Technologien Potential in der Zukunft haben werden.» Und das sage er als ehemaliger Angestellter des Bundes», sagt Brunetti, der bis 2012 die Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) leitete.
Rahmenbedingungen schaffen
Natürlich könnten im Einzelfall Unternehmen die Schweiz verlassen. «Aber es kann nicht sein, dass wir deswegen jede Subvention der EU oder anderer Staaten nachvollziehen.» Das könne sich die Schweiz gar nicht leisten, sagt Brunetti. Trotzdem müsse sie keinen Exodus ihrer Industrie befürchten. Die Schweiz habe eine breit diversifizierte Wirtschaftsstruktur und zeichne sich durch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit aus – gewährleistet durch gute Rahmenbedingungen.
Und hier sieht der Ökonom den Staat in der Pflicht. «Er muss weiter für gute Rahmenbedingungen wie ein gutes Bildungssystem, leistungsfähige Infrastruktur, ein effizientes Steuersystem und massvolle Regulierungen sorgen.» Brunetti nennt insbesondere auch stabile Beziehungen mit der EU.
Handelsabkommen abschliessen
Eine weitere Aufgabe des Staates sei der Abschluss von Freihandelsabkommen, um den Marktzugang für Schweiz Unternehmen zu erleichtern. Ansonsten seien die Unternehmen in der Pflicht, ihre Risiken zu minimieren – etwa indem sie ihre Lieferketten diversifizierten. Der Berner Professor sieht es sogar als einen «grossen Standortvorteil an, dass die Schweiz keine Industriepolitik betreibt». Unternehmen könnten sich darauf verlassen, dass der Staat auf unvorhersehbare Interventionen verzichtet und damit auch ihre Konkurrenten nicht plötzlich finanziell gefördert würden, wenn es gerade politisch opportun erscheine.
Seilziehen in der EU-Kommission
Grundsätzlich bedauert Brunetti jedoch diese Entwicklung: «Das könnten erste Schritte in Richtung einer nationalistischen Deglobalisierung sein, die für alle einen Wohlstandverlust bedeuten.» Er hoffe nicht, dass das zum Trend werde. Doch auch innerhalb der EU-Kommission gibt es Stimmen, die vor starken Markteingriffen warnen. Diese Haltung verkörpert etwa die EU-Kommissionsvizepräsidentin und Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in der Brüsseler Behörde. Der Franzose Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, steht hingegen für den interventionistischen Flügel in der EU-Kommission. Am Mittwoch wird sich zeigen, wer sich wie stark durchgesetzt hat.