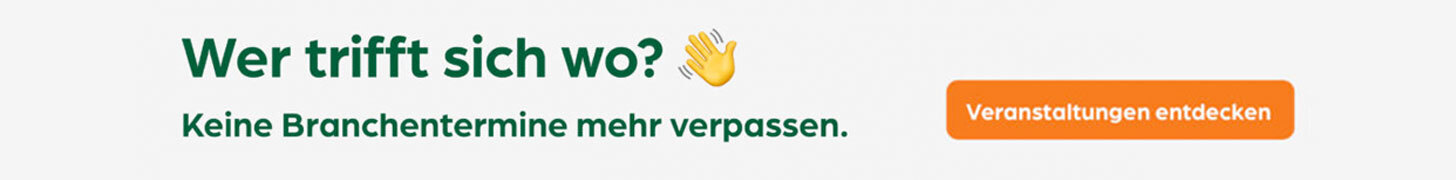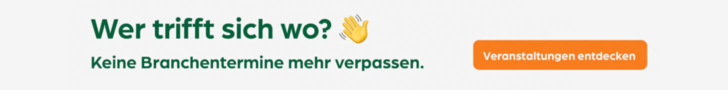Bei welchen Nahrungsmitteln machen Importe Sinn?
Christian Ritzel: Prinzipiell kann die Wirtschaft frei entscheiden, bei welchen Nahrungsmitteln sie Importe als sinnvoll erachtet. Naheliegend ist allerdings, Nahrungsmittel zu importieren, bei denen der Selbstversorgungsgrad von 100% selbst im Falle erhöhter Inlandproduktion nicht erreicht werden kann, bzw. Nahrungsmittel, die beispielsweise aus klimatischen Bedingungen nicht in der Schweiz produziert werden können wie zum Beispiel Reis, Kakao und Kaffee.
Bereits wird im Seeland Reis angepflanzt, im Gürbetal wächst Quinoa und es gibt Schweizer Pfirsiche und Ingwer im Angebot. Begrüssen Sie innovative Landwirte, die versuchen, exotische Lebensmittel in der Schweiz zu produzieren?
Stefan Mann: Natürlich! Aber eher aus Gründen der Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit als aus Gründen der Versorgungssicherheit.
Wo sehen Sie Potenzial in Bezug auf den Klimawandel?
Stefan Mann: Der Prozess der globalen Erwärmung verläuft langsam. Daher bleibt uns genug Zeit, mit den neuen Kulturen von Soja bis Reis zu experimentieren, bevor sie fester Bestandteil des Schweizer Portfolios werden.
Christian Ritzel: Der Klimawandel ist für die Schweizer Landwirtschaft schon heute spürbar. Neben negativen Auswirkungen wie zum Beispiel länger anhaltende Dürreperioden bietet der Klimawandel auch gewisse Potentiale. Gemüsesorten wie zum Beispiel Süsskartoffeln können nun auch in der Schweiz angebaut werden. Der Klimawandel bringt auch Innovationen wie die sogenannte „Klimatomate“, die mit wesentlich weniger Bewässerung auskommt, hervor.
Die Schweiz hat im Vergleich zu anderen Ländern einen eher tiefen Selbstversorgungsgrad. Schätzen Sie dies als Vor- oder Nachteil ein?
Christian Ritzel: Ein geringer Selbstversorgungsgrad ist aus Sicht der Ernährungssicherheit als Nachteil einzustufen, speziell für den Fall einer langandauernden schweren Mangellage, bei der Nahrungs- und Produktionsmittelimporte weitestgehend wegfallen. In einem solchen Fall müsste die landwirtschaftliche Produktion mit einem relativ hohen Koordinationsaufwand von der Produktion tierischer zu mehr pflanzlichen Nahrungsmitteln umgestellt werden, um den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen.
Und trotzdem schätzen Experten, dass der Selbstversorgungsgrad von 56 auf 52 Prozent sinken wird. In welchem Zeitfenster?
Stefan Mann: Unsere Berechnungen zur Agrarpolitik 22+ haben diesen Wert für das Jahr 2025 projiziert. Aus meiner Sicht bedeutet dieser Rückgang aber keinen Rückgang der Versorgungssicherheit. Er ist einer Ökologisierung der Produktion geschuldet, die auch kurzfristig wieder umgekehrt werden könnte.